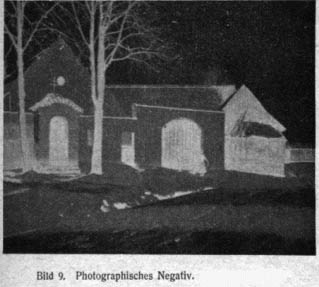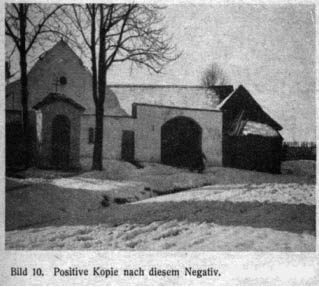|
DR. E. VOGEL
Taschenbuch
der Photographie
Ein Leitfaden für Anfänger
und Fortgeschrittene
Bearbeitet von KARL WEISS
Herausgeber der "Photographie für
alle" und des "Camera Almanach"
37. Auflage
211. bis 230. Tausend
mit 253 Abbildungen
Berlin 1922 Union Deutsche
Verlagsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin
Vorwort
Die
vorliegende Neuauflage hat wesentliche Ergänzungen
und Verbesserungen, entsprechend dem fortgeschrittenen
Stande der photografischen Technik, erfahren.
Es wurden alle wesentlichen Neuerscheinungen
beachtet und die verschiedenen Arbeitsvorschriften
durchgesehen und vielfach durch neuere ersetzt.
Ebenso wurden die Abbildungen mehrfach erneuert
und ergänzt.
 Um
dem, der zum erstenmal ein solches Lehrbuch
in die Hand bekommt, das Zurechtfinden und
Verarbeiten zu erleichtern, ist auch die
vorliegende Auflage des Taschenbuches durch
Verwendung zweier verschiedener Schriftgattungen
gegliedert. Das über die ganze Satzbreite
und in größerer Schrift Gesetzte
muss jeder wissen, der mit Verstand und
Sicherheit arbeiten will; das kleiner und
schmäler Gedruckte ist für den
Anfänger zunächst entbehrlich. Um
dem, der zum erstenmal ein solches Lehrbuch
in die Hand bekommt, das Zurechtfinden und
Verarbeiten zu erleichtern, ist auch die
vorliegende Auflage des Taschenbuches durch
Verwendung zweier verschiedener Schriftgattungen
gegliedert. Das über die ganze Satzbreite
und in größerer Schrift Gesetzte
muss jeder wissen, der mit Verstand und
Sicherheit arbeiten will; das kleiner und
schmäler Gedruckte ist für den
Anfänger zunächst entbehrlich.
 Die
in früheren Auflagen in den Text eingestreuten
Bildertafeln mussten auch in der vorliegenden
Auflage aus technischen Gründen - besonders
um das Buch nicht unnötig zu verteuern
- nach Textschluss gebracht werden. Damit
der enge Zusammenhang der Tafelbilder mit
dem Text gewahrt blieb, wurden für
die Tafelbilder die bisherigen Abbildungsnummern
beibehalten. In allen denjenigen Fällen,
wo sich bei den Textabbildungen Lücken
ergeben, sind also die fehlenden Nummern
unter den am Schlusse des Textes befindlichen
Tafelbildern zu suchen. Die
in früheren Auflagen in den Text eingestreuten
Bildertafeln mussten auch in der vorliegenden
Auflage aus technischen Gründen - besonders
um das Buch nicht unnötig zu verteuern
- nach Textschluss gebracht werden. Damit
der enge Zusammenhang der Tafelbilder mit
dem Text gewahrt blieb, wurden für
die Tafelbilder die bisherigen Abbildungsnummern
beibehalten. In allen denjenigen Fällen,
wo sich bei den Textabbildungen Lücken
ergeben, sind also die fehlenden Nummern
unter den am Schlusse des Textes befindlichen
Tafelbildern zu suchen.
Berlin-Wilmersdorf, im
August 1922.
Karl Weiß.
Seite A
Inhaltsübersicht
Seite B
Seite C
Einleitung
Die
Photographie umfasst jene Verfahren, nach
denen man mit Hilfe des Lichtes auf lichtempfindlichen
Stoffen Abbildungen von Dingen erhalten
kann. Je nachdem, ob man hierbei noch weitere
Hilfsmittel verwendet oder nicht, kann man
unterscheiden:
 1.
Die Bilderzeugung mit Hilfe von Licht und
lichtempfindlichen Stoffen allein, das Lichtpausverfahren
oder Kopierverfahren. Man legt auf
ein lichtempfindliches Papier eine Zeichnung,
ein gemaltes Glasbild oder irgendwelche
andere flache Gegenstände, z.B. Laubblätter,
und deckt darüber eine Glasscheibe;
setzt man das Ganze hellem Tageslicht oder
einer entsprechenden künstlichen Lichtquelle
aus, so wird das Papier an den unbedeckten
oder durchsichtigen Stellen allmählich
braun, bei längerer Belichtung dringt
das Licht auch durch die halbdurchsichtigen
Stellen, so dass sich z.B. bei Blättern
deren Adern markieren; so bekommt man Bilder
der Blätter, in denen der dunkelste
(undurchsichtigste) Teil hell, der durchsichtigste
dunkel ist, also umgekehrt, wie in der Natur;
solch in bezug auf Licht und Schatten verkehrtes
Abbild nennt man ein Negativ. Bild 1 zeigt
uns ein Laubblatt, in der Durchsicht betrachtet
(die wassergefüllten Blattrippen erscheinen
durchsichtiger als die Blattfläche),
Bild 2 eine derartige negative Pause davon. 1.
Die Bilderzeugung mit Hilfe von Licht und
lichtempfindlichen Stoffen allein, das Lichtpausverfahren
oder Kopierverfahren. Man legt auf
ein lichtempfindliches Papier eine Zeichnung,
ein gemaltes Glasbild oder irgendwelche
andere flache Gegenstände, z.B. Laubblätter,
und deckt darüber eine Glasscheibe;
setzt man das Ganze hellem Tageslicht oder
einer entsprechenden künstlichen Lichtquelle
aus, so wird das Papier an den unbedeckten
oder durchsichtigen Stellen allmählich
braun, bei längerer Belichtung dringt
das Licht auch durch die halbdurchsichtigen
Stellen, so dass sich z.B. bei Blättern
deren Adern markieren; so bekommt man Bilder
der Blätter, in denen der dunkelste
(undurchsichtigste) Teil hell, der durchsichtigste
dunkel ist, also umgekehrt, wie in der Natur;
solch in bezug auf Licht und Schatten verkehrtes
Abbild nennt man ein Negativ. Bild 1 zeigt
uns ein Laubblatt, in der Durchsicht betrachtet
(die wassergefüllten Blattrippen erscheinen
durchsichtiger als die Blattfläche),
Bild 2 eine derartige negative Pause davon.
 2. Die optische Bilderzeugung mit Hilfe
von Licht, lichtempfindlichen Stoffen und
einer Kamera, das
Aufnahmeverfahren. Die älteste
Art, ein solches "Kamerabild"
zu erzeugen, ist die mit Hilfe eines verdunkelten
Zimmers (italienisch: camera), dessen Fensterladen
ein kleines Loch besitzt. Wie ein solches
Bild zustande kommt, zeigt Bild 3: a sei
eine Pappel, o das Loch, w die Hinterwand
des Zimmers. Es gehen nun von jedem Punkte
der Pappel Lichtstrahlen nach dem Loche
und pflanzen sich in gerader Linie weiter
fort bis an die Wand. Nach dem Punkt á
im Zimmer kann nur Licht von dem Punkte
a der Pappel gelangen, der auf der Verlängerung
der Linie a o liegt. Dasselbe gilt für
die Punkte f´ und g´, und das
Ergebnis ist, dass auf der Wand ein verkehrtes
Bild des Baumes sichtbar wird. An Stelle
des Zimmers kann man einen kleinen Kasten
nehmen, der statt der festen Wand (W) eine
Scheibe aus Mattglas hat; auf dieser Scheibe
sieht man deutlich das Bild eines vor dem
Kasten befindlichen Gegenstandes, wenn in
die Vorderwand des Kastens ein feines Loch
gemacht wird und die Betrachtung der Mattscheibe
unter einem das hintere und das Seitenlicht
abschließenden dunklen Stoff erfolgt.
2. Die optische Bilderzeugung mit Hilfe
von Licht, lichtempfindlichen Stoffen und
einer Kamera, das
Aufnahmeverfahren. Die älteste
Art, ein solches "Kamerabild"
zu erzeugen, ist die mit Hilfe eines verdunkelten
Zimmers (italienisch: camera), dessen Fensterladen
ein kleines Loch besitzt. Wie ein solches
Bild zustande kommt, zeigt Bild 3: a sei
eine Pappel, o das Loch, w die Hinterwand
des Zimmers. Es gehen nun von jedem Punkte
der Pappel Lichtstrahlen nach dem Loche
und pflanzen sich in gerader Linie weiter
fort bis an die Wand. Nach dem Punkt á
im Zimmer kann nur Licht von dem Punkte
a der Pappel gelangen, der auf der Verlängerung
der Linie a o liegt. Dasselbe gilt für
die Punkte f´ und g´, und das
Ergebnis ist, dass auf der Wand ein verkehrtes
Bild des Baumes sichtbar wird. An Stelle
des Zimmers kann man einen kleinen Kasten
nehmen, der statt der festen Wand (W) eine
Scheibe aus Mattglas hat; auf dieser Scheibe
sieht man deutlich das Bild eines vor dem
Kasten befindlichen Gegenstandes, wenn in
die Vorderwand des Kastens ein feines Loch
gemacht wird und die Betrachtung der Mattscheibe
unter einem das hintere und das Seitenlicht
abschließenden dunklen Stoff erfolgt.
1 über die chemischen
Wirkungen des Lichts siehe Grundlagen der
Photographie von Prof. Dr. W. Scheffer,
Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin
Seite 2
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis
 Heller
und schärfer erscheinen diese Bilder,
wenn man an Stelle des Loches eine Glaslinse
setzt. Diese Linse entwirft in einer gewissen
Entfernung ein deutliches Bild der Gegenstände,
das man nun auf einen lichtempfindlichen
Stoff wirken kann; man erhält dadurch,
ebenso wie beim Lichtpausverfahren, ein
negatives Bild; dieses kann man nun nach
dem Lichtpausverfahren kopieren, d.h. auf
eine lichtempfindliche Fläche auflegen
und diese wirken lassen; man erhält
wiederum eine Umkehrung des Bildes, also
jetzt ein nach Licht und Schatten richtiges,
positives Bild. Heller
und schärfer erscheinen diese Bilder,
wenn man an Stelle des Loches eine Glaslinse
setzt. Diese Linse entwirft in einer gewissen
Entfernung ein deutliches Bild der Gegenstände,
das man nun auf einen lichtempfindlichen
Stoff wirken kann; man erhält dadurch,
ebenso wie beim Lichtpausverfahren, ein
negatives Bild; dieses kann man nun nach
dem Lichtpausverfahren kopieren, d.h. auf
eine lichtempfindliche Fläche auflegen
und diese wirken lassen; man erhält
wiederum eine Umkehrung des Bildes, also
jetzt ein nach Licht und Schatten richtiges,
positives Bild.
 Die
photographische Bilderzeugung setzt sich
also (von später zu erörternden
Ausnahmen, S.
94 und 104,
abgesehen) aus zwei Vorgängen zusammen: Die
photographische Bilderzeugung setzt sich
also (von später zu erörternden
Ausnahmen, S.
94 und 104,
abgesehen) aus zwei Vorgängen zusammen:
 A.
der Erzeugung eines Negativs auf einer mit
einer lichtempfindlichen Schicht überzogenen
Glasplatte mit Hilfe von Kamera und Linse, A.
der Erzeugung eines Negativs auf einer mit
einer lichtempfindlichen Schicht überzogenen
Glasplatte mit Hilfe von Kamera und Linse,
 B.
der Herstellung eines Positivs nach diesem
Negativ mit Hilfe des Kopierverfahrens. B.
der Herstellung eines Positivs nach diesem
Negativ mit Hilfe des Kopierverfahrens.
 Wir
müssen ferner noch unterscheiden, ob
das Bild durch das Licht sofort sichtbar
gemacht wird (Auskopierverfahren),
oder ob die Folge der Lichteinwirkung unsichtbar
ist, und ob erst durch eine chemische Behandlung
daraus ein sichtbares Bild hervorgerufen
wird
(Entwicklungsverfahren). Das Entwicklungsverfahren
verlangt nur eine viel tausendmal schwächere
Lichtwirkung, man verwendet es daher bei
der Aufnahme (A), das weniger empfindliche
Auskopierverfahren wird beim Kopieren (B)
verwendet. Wir
müssen ferner noch unterscheiden, ob
das Bild durch das Licht sofort sichtbar
gemacht wird (Auskopierverfahren),
oder ob die Folge der Lichteinwirkung unsichtbar
ist, und ob erst durch eine chemische Behandlung
daraus ein sichtbares Bild hervorgerufen
wird
(Entwicklungsverfahren). Das Entwicklungsverfahren
verlangt nur eine viel tausendmal schwächere
Lichtwirkung, man verwendet es daher bei
der Aufnahme (A), das weniger empfindliche
Auskopierverfahren wird beim Kopieren (B)
verwendet.
Seite 3
zur
Inhaltsübersicht zum
Stichwortverzeichnis zum
Stichwortverzeichnis weiter weiter
|